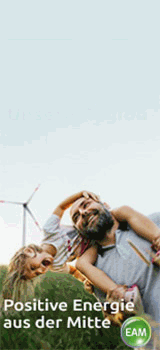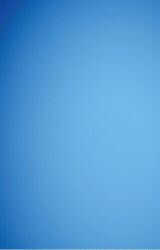Neuer Antiziganismusbeauftragter in Rheinland-Pfalz will Misstrauen abbauen
Michael Hartmann, der erste Antiziganismusbeauftragte in Rheinland-Pfalz, hat große Pläne. Sein Ziel ist es, das Verständnis zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den Sinti und Roma zu fördern. Dies ist Teil eines neuen Landesgesetzes zum Schutz dieser Minderheit.

Mainz. "Wechselseitig mehr Verständnis erreichen" - so beschreibt Michael Hartmann seine Hauptaufgabe als neuer Antiziganismusbeauftragter in Rheinland-Pfalz. Der Leiter des Referats Europa, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und nationale Minderheiten im Innenministerium betont die Vielfalt innerhalb der Gruppe der Sinti und Roma, die seit über 600 Jahren in Deutschland leben. Er warnt vor schnellen Zuschreibungen und betont, dass diese Gemeinschaft ebenso heterogen sei wie andere Bevölkerungsgruppen.
Jacques Delfeld, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz, weist darauf hin, dass Sinti und Roma am stärksten von Antiziganismus betroffen sind. Auch Menschen mit ost- oder südosteuropäischem Migrationshintergrund leiden unter dem Stigma, sagt Delfeld. Er hofft auf ein besseres gesellschaftliches Problembewusstsein für Antiziganismus, ähnlich wie beim Antisemitismus.
Hartmann schätzt, dass mindestens 10.000 Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz leben. Bekannte Persönlichkeiten aus dieser Gemeinschaft sind Angehörige der Musikerfamilie Reinhard, die ehemalige Deutsche Weinkönigin Angelina und der Grünen-Politiker Romeo Franz.
Der Wunsch nach einem Antiziganismusbeauftragten kam aus den Reihen der Sinti und Roma selbst. Hartmann sieht sich als Vermittler und plant, Fälle von Antiziganismus zu überwachen, um ein fundiertes Bild der Situation zu erhalten. Betroffene sollen Vorfälle melden können, insbesondere solche, die unterhalb der strafrechtlichen Schwelle liegen.
Delfeld erklärt, dass antiziganistische Stereotypen oft geschickt verpackt werden und führt die Skepsis der Sinti und Roma gegenüber staatlichen Institutionen auf historische Erfahrungen zurück. Viele Überlebende des Zweiten Weltkriegs seien mit ihren Traumata allein gelassen worden.
Hartmann möchte dieses Misstrauen abbauen und verweist auf die Notwendigkeit der historischen Aufarbeitung. Dabei soll auch die Universität Mainz eine Rolle spielen. Er betont, dass er nicht für die Verbände da sei, sondern für die von Antiziganismus bedrohten Menschen.
Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus erfasste 2024 insgesamt 52 Vorfälle, was einen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren darstellt. (dpa/bearbeitet durch Red)
Mehr dazu:
Politik & Wahlen
Feedback: Hinweise an die Redaktion